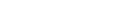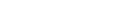Eine HPV-Infektion verursacht zu Beginn keinerlei Symptome und die meisten Menschen sind in der Lage, unbemerkt die Infektionen mit ihrem eigenen Immunsystem erfolgreich zu bekämpfen. Aus diesem Grund ist es auch nicht notwendig, nach einer HPV-Infektion zu suchen, vor allem auch deshalb nicht, weil das Wissen um das Vorhandensein einer HPV-Infektion bei vielen Frauen Gefühle wie Unsicherheit, Angst, Wut und Scham auslösen können. Dieser Umstand beeinträchtigt dann vielfach das Sexualverhalten und beeinträchtigt den genussvollen und erfüllenden Umgang mit Sexualität. Nach den Empfehlungen der neuesten Guidelines soll Frauen ab dem 30. Lebensjahr ein HPV- Test alle 3 Jahre empfohlen werden. Dies soll übermäßige Kontrollen vermeiden.
Es ist daher besonders wichtig zu vermitteln, dass HPV-Infektionen fast so häufig sind wie Infektionen mit dem Schnupfenvirus und dass diese Infektion in den allermeisten Fällen von selbst verschwindet. Aus diesem Grund ist es auch überflüssig, Angst vor der Übertragung zu haben, da ja fast jeder sexuell aktive Mensch irgendwann eine HPV-Infektion bekommt. Außerdem gibt es keine in ihrer Wirksamkeit bewiesene Behandlung gegen eine symptomlose HPV-Infektion.
Anders sieht es mit der Diagnose von krankhaften Veränderungen aus, die von einer HPV-Infektion verursacht werden können. Hier ist an erster Stelle der regelmäßige Krebsabstrich (Pap-Abstrich) im Rahmen der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt oder der Frauenärztin zu erwähnen. Dabei wird mit einem Bürstchen über die Oberfläche des Gebärmutterhalses gestrichen und die Zellen, die sich dabei im Bürstchen verfangen, werden auf einen Objektträger ausgestrichen und dieser unter dem Mikroskop untersucht. Hat eine HPV-Infektion zu einer Vorkrebsveränderung geführt, findet man mit großer Wahrscheinlichkeit auffällige Zellen im Abstrich. Je nach Schweregrad wird die Bezeichnung Pap IIID oder Pap IV gewählt.
Liegt nun ein solches Ergebnis vor, dann ist der nächste Schritt, eine Kolposkopie durchzuführen. Dabei wird der Gebärmutterhals mit einer wässrigen Essiglösung gefärbt und unter dem Vergrößerungsglas angesehen und im Bedarfsfall eine kleine Gewebeprobe gewonnen. Diese wird dann wiederum im Mikroskop untersucht und eine Diagnose wie zum Beispiel CIN I bis III (siehe weiter oben) gestellt. Die Kolposkopie und Biopsie stellt auch die Methode der Wahl zur Diagnose von Vorkrebsveränderungen von Scheide (VAIN), des Scheideneinganges (VIN) und des Analkanals (AIN) dar.
Es ist auch möglich, das Virus nachzuweisen. Dabei wird gleich wie beim Krebsabstrich mit einem Bürstchen über den Gebärmutterhals gestrichen und das Bürstchen anschließend in ein Röhrchen gegeben. Im Rahmen einer speziellen Laboruntersuchung wird dann das Virus mittels Polymerasekettenreaktion (PCR) im Reagenzglas so weit vermehrt, dass es schließlich nachgewiesen werden kann. Zwei Testverfahren sind derzeit häufig in Gebrauch. So wird zum Beispiel mit dem cobas®-Test der Firma Roche aus der Gruppe der „Hochrisiko“-Typen nur die Virustypen HPV 16 und 18 extra bestimmt, alle anderen in einer Gruppe, dem sogenannten „Pool“ zusammengefasst. Mit dem PapilloCheck®-Test der Firma Greiner hingegen kann festgestellt werden, um welchen Virustyp es sich im Speziellen handelt.